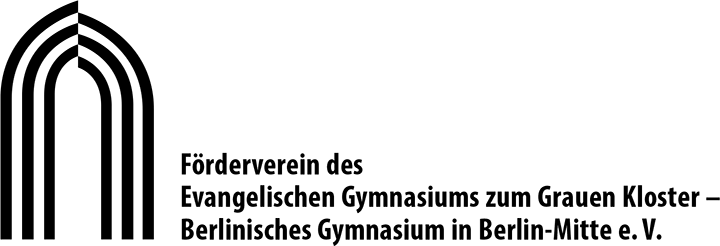Gregor Hohberg
Foto: Klemens Renner
In der Mitte der Stadt
Gregor Hohberg
Wenn Sie eine Stadt planen und bauen dürften, was würde für Sie in die Mitte der Stadt gehören? Diese Frage wurde dem Architekten Meinhard von Gerkan gestellt. Er plant und baut zur Zeit mit seinem Hamburger Büro in China eine neue Stadt für 300.000 Einwohner. In seiner Antwort verwies er darauf, dass man in den 70er Jahren wohl ein Einkaufszentrum in die Mitte der Stadt gesetzt hätte mit den entsprechenden Konsequenzen – vornehmlich breiten, autogerechten Verkehrswegen und Parkhäusern. Das habe dann die Lebensqualität der dort wohnenden Menschen erheblich eingeschränkt. Aus diesem Grund hat er für die neue Stadt „Luchano“ eine Mitte ohne Kommerz und Handel entworfen. Gedacht ist stattdessen daran, einen See von 2,5 Kilometern Durchmesser anzulegen. Die Mitte der Stadt soll von einem öffentlichen, menschenfreundlichen Ort geprägt sein, an dem Menschen sich begegnen und ins Gespräch kommen können. Ob das reichen wird, um zukunftsorientierte Sinnpotentiale freizusetzen? Ob die Menschen finden werden, was sie suchen, wenn es sie ins Stadtzentrum zieht?
Traditionell werden in Europa an die Stadt und insbesondere an ihre Mitte viel weitergehende Erwartungen und Ansprüche gestellt. Eines der ältesten Stadtsymbole ist das Sonnenrad. Ein Kreis, der durch ein Achsenkreuz zu einem Rad mit vier Speichen wird. Dieses Ursymbol meint: die Stadt ist die irdische Sonne, von ihr geht Orientierung aus, insbesondere von ihrer Mitte, dem Schnittpunkt der vier Himmelsrichtungen. Wie selbstverständlich wurden die Zentren der Städte Europas darum durch die Jahrhunderte hindurch von den herrschenden Mächten besetzt. Das waren in der Regel die politische, die ökonomische und die geistliche Macht. Baulich manifestiert als Rathaus, Markt und Kirche prägten sie die Orientierung, die von der Stadtmitte ausgehen sollte und ausging.
Diese klassische Trias ist selbst im Zentrum von Berlin noch zu erahnen. Auch wenn hier die politische Macht im Gefolge der Zerstörungen des 2. Weltkrieges versucht hat – ohne Rücksicht auf gewachsene Strukturen die sozialistischen Hauptstadtplanungen umsetzend – die Kirchen städtebaulich zu marginalisieren. Doch es gibt sie noch – Gottes Häuser im Herzen der Stadt, Kirchen, die als Kirchen genutzt werden. Allein die Mariengemeinde, die fast das gesamte Gebiet der historischen Altstadt Berlins umfasst, ist für zwei Kirchen verantwortlich. Berlins älteste (durchgehend erhaltene) Kirche, St. Marien und Berlins erste Barockkirche von Rang, die Parochialkirche. Diese Kirchen, ihre Geschichte und ihre Ausstrahlung und ihre Lage im Zentrum Berlins, in der Hauptstadt des Landes und damit auch in der ideellen Mitte des ganzen Landes, sind eine große Herausforderung und Chance für den Auftrag der Kirche. Dort, wo alle Menschen und Gruppierungen hindrängen, um wahrgenommen zu werden mit ihrem Anliegen, um sich Gehör zu verschaffen mit ihren Vorstellungen vom Wohl und Wehe der Stadt und des Landes, dort, wo Orientierungsangebote inszeniert werden und die prägenden Gestaltungskräfte der Gesellschaft um das zukünftige Antlitz des Landes ringen, dort wo Menschen nach Antworten suchen: genau dort stehen unsere Kirchen.
Bis zum heutigen Tage halten es Besucher, die eine ihnen unbekannte Stadt kennenlernen möchten, mit gutem Grund so, dass sie die Peripherie zügig und unbesehen durchqueren, um in die Mitte der Stadt zu gelangen. Gesucht wird ihr Ursprung, der Ort, von dem alles ausging, der den genius loci, das je Spezifische bewahrt und erfahrbar macht. Die orientierende Mitte zieht magisch an.
Das gilt auch für Berlin, kann hier aber zu einem bösen Erwachen führen. Dort, wo sich vor dem Krieg und dem sozialistischen Umbau die Altstadt, das historische Zentrum Berlins befand, prägen heute zugige Freiflächen, überdimensionierte Straßen, Parkhäuser und gesichtslose Großbauten der Spätmoderne die Stadt. Der Platz zwischen der Marienkirche und dem Roten Rathaus ist der größte Platz der Stadt. Er hat nicht einmal einen Namen. Die vielen Namen, die es einst gab, schlummern im Untergrund, denn unter dem Platz liegt ein Drittel des alten Berlin begraben – Häuser, Gassen, Plätze. An den Rand gedrängt, von Grünanlagen verhüllt St. Marien.
Noch schmerzhafter stellt sich die Situation hinter dem Rathaus, um die Parochialkirche herum, dar. Eine Schnellstraße, zwei neu errichtete Parkhäuser und eine Kreuzung, die über vier Hektar groß ist, trennen die Reste des Klosterviertels von der Stadt ab und schaffen eine unwirtliche Verwaltungsbrache, die wirkt, als läge sie an der Peripherie einer beliebigen Stadt.
Was für eine Art Orientierung geht von einer Mitte aus, die dem Fortkommen und Durchfahren soviel Platz bietet? Warum werden Handel, Konsum und Autoverkehr so viel Platz eingeräumt, genau dort, wo die Menschen nach dem Ursprung Berlins suchen, wo sie über Fragen der Geschichte und Zukunft diskutieren wollen?
Die derzeitige Bebauung des Stadtzentrums nimmt weder Bezug auf die Geschichte der Stadt, noch bietet sie den Menschen genügend öffentlichen Raum für Begegnung und Diskurs.
Die Mariengemeinde begrüßt und unterstützt darum ausdrücklich die Pläne des Senats zur Reurbanisierung des Klosterviertels, insbesondere den Masterplan des Büros Riemann und Luther. Dieser Entwurf verdeutlicht, dass sich riesige Potentiale zur Wiederbelebung der Berliner Altstadt freisetzen lassen, wenn man unbefangen und ohne ideologische Scheuklappen die vorhandenen „konfessionell geprägten Orte“ der Innenstadt wahrnimmt und nutzt als das, was sie immer waren und wieder sein sollten: „geistiger und kultureller (und geistlicher) roter Faden“ des historischen Zentrums von Berlin. Im Klosterviertel wären das die Parochialkirche, der Jüdenhof, wenn er denn von der jüdischen Gemeinde mit Leben erfüllt wird und die Klosterkirche als Herz des am historischen Ort wiedererstehenden Evangelischen Gymnasiums zum Grauen Kloster. Das Anknüpfen an beste Berliner Bildungstradition, die das Graue Kloster verkörpert, die Wiederbelebung der Klosterkirche durch die Verknüpfung mit dieser altehrwürdigen Institution, eine zukunftsorientierte Schule fest verwurzelt im Gedächtnis der Stadt und in der Religion des Abendlandes – etwas Besseres kann dem Klosterviertel und kann Berlin-Mitte nicht widerfahren.
Wenn ich eine Stadt bauen dürfte, dann würde ich eine Kirche in ihre Mitte stellen.
In der Mitte Berlins befinden sich bereits Kirchen. Wir sollten alles dran setzen, der Stadt ins Gedächtnis rufen, was sie an den Kirchen hat. Gerade auch durch die Kirchen, nicht durch Verwaltungsgebäude oder Einkaufszentren, wird das unverwechselbare Gesicht einer Stadt geprägt. Es geht dabei nicht nur um den ästhetischen Aspekt, um die Freude an einer schönen Stadt. Für die Seele einer Stadt und für die ihrer Bewohner sind „Heterotopien“ nötig, andere Orte, die unverwechselbar für das Bleibende stehen, die auf Ursprung und Herkunft verweisen. Kirchen sind Regenerationsorte für die Seele des Menschen und der Stadt, sie sind Herbergen für verdrängte Gefühle, Segensräume für das Leben und Dialogräume für den Stadtfrieden.
In all dem deuten sich Möglichkeiten an, die wir als Kirchengemeinde nicht allein ausschöpfen können und auch allein ausschöpfen wollen. Im Gegenteil, wir sind uns bewusst, dass unsere Kirchen ebensoviel Stadt wie Religion repräsentieren, und wir hoffen darauf, dass die Berlinerinnen und Berliner in stärkerem Maße als in den letzten Jahrzehnten Mitgestalter ihrer Kirchen sein werden, dass sie Interesse zeigen für eine Kirche, die in sorgsamer Wachheit zum Wohle der Stadt den christlichen Glauben lebt.
Die Mariengemeinde sieht sich dabei in einer Jahrhunderte alten Tradition eines sich gegenseitig bereichernden Miteinanders von Bürgergesellschaft und Kirche. Diese Tradition zeitgemäß zu entfalten, ist der Mariengemeinde ein zentrales Anliegen. Wir wünschen uns die breite Partizipation an Nutzung und Pflege unserer Kirchen, dieser Stadtsymbole, dieser Schatzhäuser der Berliner Geschichte, dieser Orte, die das Gewissen schärfen und dieser Hoffnungsinseln im Meer der Zeit. Für sie ist ein bebautes und bewohnbares Umfeld wichtig, ein Umfeld, das diese altehrwürdigen Steine fasst, das sich auf die historische Struktur Altberlins bezieht, kurzum: das den alten Stadtkirchen die Stadt zurückgibt, die Stadt und ihre Bewohner.
Das Klosterviertel, dieser Urort Berlins, schreit nach Befreiung von Brachflächen und sehnt sich nach einem menschlichen Maß und nach Bewohnern, die es ins Herz der Stadt zieht – um der Seele willen und für Berlin.
Gregor Hohberg ist Pfarrer der Marien- und Parochial-Gemeinde in Berlin-Mitte. Sein Plädoyer für die Mitte der Stadt hielt Pfarrer Hohberg im Rahmen eines Architekturgesprächs zur Planung des Klosterviertels in der Parochialkirche am 26.4.2005.
Vortrag im Rahmen eines Architekturgesprächs in der Parochialkirche am 26. April 2005, in: DAS GRAUE KLOSTER 2008, S. 52 f.